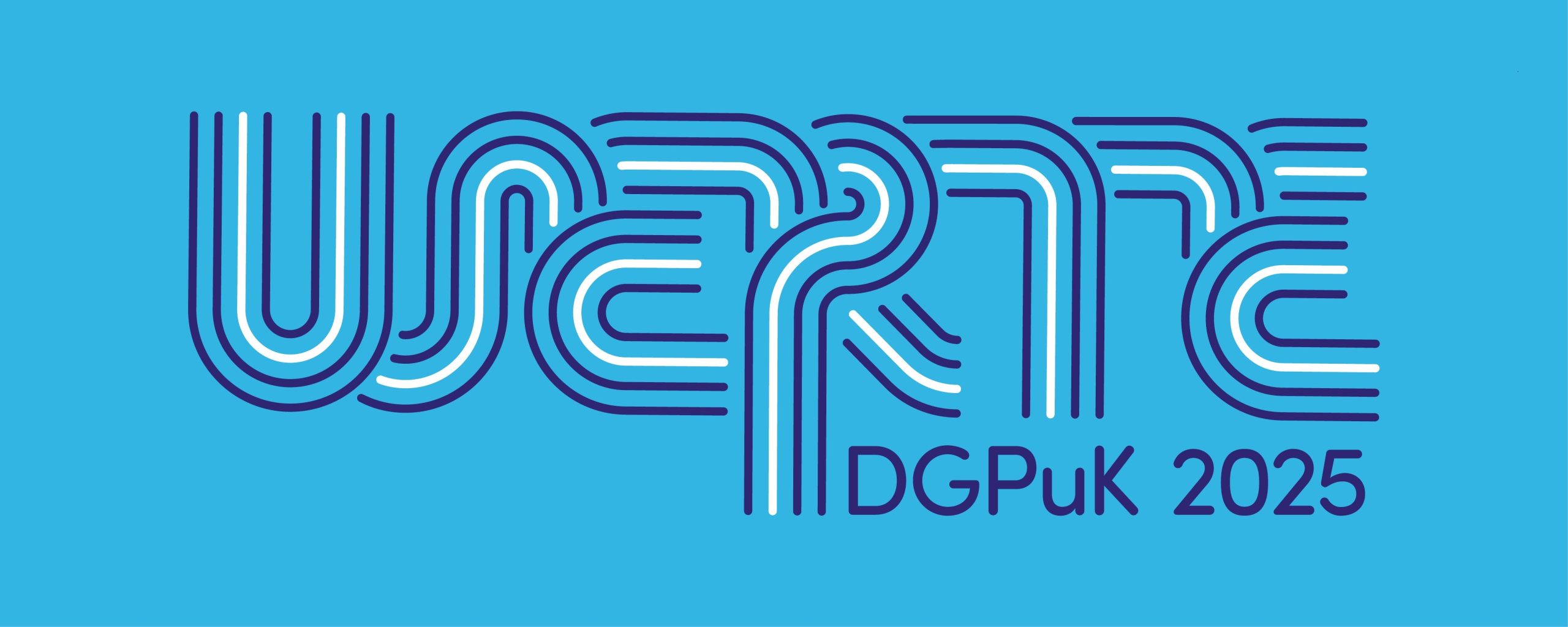Freitag, 21.03.25, 13.30-15.00 Uhr, Henry-Ford-Bau – Hörsaal A
KI und digitale Öffentlichkeit: Stärkung der Demokratie?
Die Wahlkämpfe im Superwahljahr 2024 und auch vor der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 waren von der Sorge begleitet, dass sich „Künstliche Intelligenz“ negativ bemerkbar machen könnte, dass z. B. Deep Fakes manipulativ eingesetzt werden. Neben solchen Risiken stellt sich aber auch die Frage nach den Chancen: Was kann KI leisten, um die öffentliche Meinungsbildung zu stärken, die Artikulationsfähigkeit der Bürger*innen zu fördern oder um Nachrichten zu recherchieren, zu prüfen, auszuwählen und zu schreiben? Ist die KI-Regulierung geeignet, Schaden von demokratischen Prozessen, Institutionen und Akteuren abzuwenden? Lässt sie genügend Spielraum für die Weiterentwicklung der KI? Das Podium deckt unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema ab: die rechts- und politikwissenschaftliche Sicht, die regulatorische Sicht der Landesmedienanstalten und die Sicht der journalistischen Praxis.
Moderation: Christoph Neuberger
Rebecca Ciesielski
Reporterin BR AI + Automation Lab I
BR Data
Andreas Jungherr
Lehrstuhl für Politikwissenschaft,
insbesondere Digitale Transformation
Universität Bamberg
Eva Flecken
Direktorin der Medienanstalt Berlin-
Brandenburg (mabb), Vorsitzende
der Direktorenkonferenz der
Landesmedienanstalten (DLM)
Sandra Wachter
Oxford Internet Institute der University of
Oxford, Humboldt-Professur für Künstliche
Intelligenz 2025, Hasso-Plattner-Institut
(HPI) und Universität Potsdam (UP)
Freitag, 21.03.25, 13.30-15.00 Uhr, Henry-Ford-Bau – Hörsaal C
Wider die nationale Schließung:
Die Potentiale von Diversität und Internationalisierung für die deutschsprachige Kommunikationswissenschaft
„Diversität“ und „Internationalisierung“ sind einerseits buzzwords, die rhetorisch vielfach im Munde geführt, die personellen wie inhaltlichen Strukturen der deutschsprachigen Kommunikationswissenschaft jedoch bislang kaum verändert haben. Zugleich erscheinen die Begriffe im aktuellen politischen Zeitgeist als umkämpfte normative Ideale, an denen gesellschaftliche, aber auch wissenschaftliche Wertedebatten ausgetragen werden. Dieses Panel nimmt sich der Debatte an und will die Relevanz und das Potential der Integration von diversen und internationalen Perspektiven, Forschungsgegenständen und Personen in die deutschsprachige Kommunikationswissenschaft aufzeigen. Im Kontrast zu einer häufig geführten Defizit-Argumentation erörtern die Panelist:innen mit Verweis auf best-practice Beispiele und ihre eigenen Erfahrungen, wie Diversität und Internationalität zu einem konstitutiven Wert für Forschung, Lehre und Transfer in die Praxis werden können.
Das Panel diskutiert unter anderem die Fragen: Warum und wie kann die hiesige Kommunikationswissenschaft von Perspektiven und Personen aus dem Globalen Süden profitieren? Welche Relevanz haben bestimmte Konzepte und Theorien für ein Verständnis von globalen Kommunikationsprozessen und was bedeutet das für unsere Wissensproduktion? Sind unsere Forschungsgegenstände und Ansätze divers genug, um globale gesellschaftliche Phänomene und Konflikte adäquat verstehen zu können? Welchen Praxistransfer können wir mit der stärkeren Inklusion von Diversität und Internationalisierung in unsere Lehre und Forschung in welche Felder leisten?
Moderation: Carola Richter & Margreth Lünenborg
Hanan Badr
Universität Salzburg
Stefanie Averbeck-Lietz
Universität Greifswald
Anne Grüne
Universität Erfurt
Ana-Nzinga Weiß
Universität Rostock